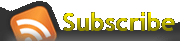Von der Politischen Kultur zur Parlamentarischen Kultur
In den 1950er Jahren gingen die amerikanischen Soziologen Gabriel Almond und Sidney Verba der Frage nach, warum sich parlamentarische Demokratien nach dem Ersten Weltkrieg in autoritäre bzw. totalitäre Regime verwandelten. Der bis dahin vorherrschende institutionenzentrierte Ansatz hatte die Transformation von Demokratie zur Diktatur nur unzureichend erklären können: Nach dem Ersten Weltkrieg gab es beispielsweise in Großbritannien, Deutschland und Polen jeweils eine Verfassung, ein Parlament und freie Wahlen. Diese Gemeinsamkeit konnte die unterschiedliche politische Entwicklung in diesen drei Ländern nicht erklären. Passte die »Hardware« – die demokratischen Institutionen – nicht zur »Software« – dem politischen Bewusstsein der Bürger?
Zur Beantwortung dieser Frage führten Almond und Verba den Begriff der »political culture« ein. Sie verstanden darunter die emotionalen und beurteilenden Einstellungen zu politischen Fragestellungen – insbesondere zur generellen Ordnung eines Landes. Prozesse der individuellen Sozialisation wurden ebenso erfasst wie kollektive Erfahrungen. Politische Kultur kann als ein Konzept verstanden werden, welches Erfassungen auf der (auf Einzelpersonen bezogenen) Mikroebene mit Aussagen für die (auf das gesamte politische System bezogenen) Makroebene zu verbinden sucht.
In ihrem Klassiker »Civic culture« (1963) bestimmten Almond und Verba unterschiedliche Typen von politischer Kultur. Sie unterschieden dabei zwischen Personen und Gruppen,
1) die keinerlei Orientierung zum politischen System haben (parochial political culture),
2) die nur auf die Output-Strukturen des Staatsapparates orientiert sind (subject political culture),
3) die sich sowohl an den Input- als auch an den Output-Strukturen des Systems orientieren (participant political culture),
4) und jene, die eine Mischform eine Mischform dieser drei Typen darstellen (Staatsbürgerkultur bzw. civic culture).
Die Studie basierte auf Interviews mit Bürgern aus fünf Staaten: USA, Großbritannien, Deutschland, Italien und Mexiko. Den USA und Großbritannien wurde das Vorhandensein einer »Zivilgesellschaft« attestiert, welche die Stabilität der Demokratie erklären könne.
Die Befassung mit der politischen Kultur eines Landes hat sich in den letzten Jahren ausdifferenziert. Ausgehend von den Fragestellungen und den Methoden zur Erforschung der »Politischen Kultur« haben sich Historiker und Politologen mit der »Parlamentarischen Kultur« beschäftigt.
Sabine Lemke-Müller untersuchte in ihrer im Jahre 2000 erschienen Studie »Abgeordnete im Parlament. Zur Parlamentskultur des Deutschen Bundestages in den neunziger Jahren« die »informelle Parlamentskultur« auf der Grundlage einer empirischen Befragung der MdB. Sie definierte Parlamentskultur als den Umgang der Abgeordneten miteinander.
Ihre Arbeit war in drei Teile gegliedert:
I. Das Parlament als flexibles Mehrheits- und Verhandlungssystem (Bundestagspräsident, Präsidium, Ältestenrat, Ausschußsitzungen, Fraktionen, Vermittlungsausschuss).
II. Inhaltliche Dimensionen von Parlamentskultur (Selbstverständnis, Bewertung von Darstellungschancen, Einfluß und Hierarchie, Vertrauensbeziehungen und Kooperation, Perzeption der Geschlechterverhältnisse).
III. Empirischer Teil der Untersuchung.
Thomas Mergels 2002 veröffentlichte Studie »Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik. Politische Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im Reichstag« stellt die bisher gelungenste und ausführlichste Analyse dar. Mergel untersuchte die Lebenswelt der Abgeordneten und »folgte« ihnen dabei in den Baderaum und in das Restaurant. Sein besonderes Augenmerk galt den interfraktionellen Formen der Vergesellschaftung, die zumeist auf der Basis gemeinsamer Charakteristika wie Alter, Geschlecht oder Herkunft erfolgten.
Mergel gliederte seine Arbeit wie folgt:
I. Das Parlament als sozialer Raum (1. Das Parlamentsgebäude und sein Umfeld, 2. Die Abgeordneten und ihre Lebenswelt: Alter, Auskommen, Lebensweise, 3. Das Parlament als symbolischer Raum (Eröffnungssitzung, Immunität).
II. Die Praxis der parlamentarischen Arbeit (1. Geschäftsordnung, Entstehung von Gesetzen, 2. Verfahrens- und Verhandlungsformen im Plenum, den Ausschüssen, den Fraktionen, im Ältestenrat, durch den Reichstagspräsidenten).
III. Politische Kommunikation zwischen Konflikt und Integration (1. Geheime Einigkeiten und symbolische Konflikte, 2. das Bemühen um Verständigung, 3. Informelle Regeln des parlamentarischen Sprechens, 4. Inklusion und Exklusion durch Politische Sprachen, 5. Inszenierung der Plenardebatten).
IV. Das Parlament und die Öffentlichkeit (1. Fragmentierte Öffentlichkeit, 2. Die Kommunikation des Parlaments mit der Gesellschaft (Besucher, Presse, Literatur, Darstellung im Bild), 3. Diskurse über Reichstag und Parlamentarismus).
In dem von Andreas Wirsching herausgegebenen Sammelband »Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie. Die Weimarer Republik im europäischen Vergleich« sind die Beiträge einer von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte im Jahre 2005 veranstalteten Tagung abgedruckt. Die Teilnehmer richteten ihren Fokus auf die Kriegsfolgen, das Parteiensystem, die Rolle der Verbände sowie die sozial- und arbeitsmarktpolitischen Problemen der Zwischenkriegszeit.
Wirsching verwies in seiner Einleitung auf die von Theodor Schieder entwickelte Nationalstaatstypologie. Nicht nur der Kriegsausgang und das Versailler System hätten die Entwicklung der behandelten Staaten determiniert, sondern auch die unterschiedlichen Erfahrungen bei der Ausbildung eines Nationalstaats und der Demokratie.
In der deutschen Debatte über den Untergang der Weimarer Republik wird die fragmentierte politische Kultur als ein Kausalfaktor benannt. Wie Wirsching in seinem Forschungsüberblick zur Politik und Gesellschaft der Weimarer Republik festgestellt hat, »besitzt das Konzept der fragmentierten Teilkulturen ein erhebliches Erklärungspotential für den Mangel an politischem Konsens, der die Weimarer Republik in so schwerwiegender Weise beeinträchtigt hat«.
Mergels Studie relativiert die Erklärungskraft dieses Ansatzes für die Parlamentarische Kultur. Wie hätten die Abgeordneten des amerikanischen Kongresses oder des britischen Unterhauses auf die Beeinträchtigung der Demokratie und der Souveränität des Parlaments durch einen »diktierten« Friedensvertrag reagiert?
Literatur:
– Almond, Gabriel und Sidney Verba: The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton 1963.
– Eisenberg, Christiane (Hrsg.): Parlamentskulturen. Britische und deutsche Perspektiven, Trier 2001.
– Gerlich, Peter: Parlamentarische Kultur, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 13 (1984), S. 21–24.
– Gerlich, Peter: Anspruch und Wirklichkeit. Das mitteleuropäische Parlamentsverständnis im Übergang, in: Peter Gerlich, Fritz Plasser und Peter A. Ulram (Hrsg.): Regimewechsel. Demokratisierung und politische Kultur in Ost-Mitteleuropa. Wien 1992, S. 79–98.
– Gosewinkel, Dieter und Gunnar Folke Schuppert: Politische Kultur. Auf der Suche nach den Konturen eines schillernden Begriffs, in: Dieter Gosewinkel (Hrsg.): Politische Kultur im Wandel von Staatlichkeit, Berlin 2007, S. 11–40.
– Kaase, Max: Perspektiven der Forschung zur politischen Kultur, in: Dieter Gosewinkel (Hrsg.): Politische Kultur im Wandel von Staatlichkeit, Berlin 2007, S. 387–397.
– Kocka, Jürgen und Jürgen Schmidt: Politische Kultur aus historischer Perspektive, in: Dieter Gosewinkel (Hrsg.): Politische Kultur im Wandel von Staatlichkeit, Berlin 2007, S. 41–61.
– Lammert, Norbert: Weder machtlos noch allmächtig. Parlamentskultur in Deutschland. Sonntagsmatinee 9. Juli 2006, Berlin 2006.
– Lemke-Müller, Sabine: Abgeordnete im Parlament. Zur Parlamentskultur des Deutschen Bundestages in den neunziger Jahren. Rheinbreitbach 1999.
– Mayntz, Renate und Friedhelm Neidhardt: Parlamentskultur: Handlungsorientierungen von Bundestagsabgeordneten. Eine empirisch explorative Studie, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 20 (1989) S. 370–387.