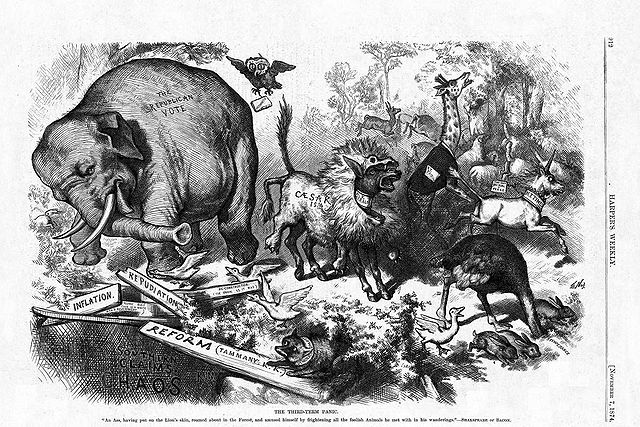Bemerkungen zur Bedeutung und zur Rolle des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages in den Jahren von 1949 bis 1961
Auswärtiger Ausschuß und Außenpolitik?
Was hat die Institution mit dem Politikfeld gemeinsam, vom Namen einmal abgesehen? Wer in den Darstellungen zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach Ausführungen zu dem Einfluß und der Bedeutung des Auswärtigen Ausschuß Ausschau hält, wird nur wenige Sätze – meist en passant eingestreut – finden. Und dies ist nicht weiter überraschend. Die vornehmste Aufgabe des Parlaments, die Kontrolle der Regierung, ist in der Außenpolitik noch viel schwieriger als in anderen Politikfeldern. Bei allen die Innenpolitik betreffenden Politikfeldern sind die wichtigsten Interessengruppen durch Abgeordnete im Parlament vertreten. Das politische System genügt sich selbst. Etwas anderes ist es mit der Außenpolitik. Das Ausland ist nicht durch Interessenvertreter im Parlament vertreten.
Die Abgeordneten sind auf Zeitungsberichte, eigene Kontakte und auf die Informationen der Regierung angewiesen. Die staatlichen Stellen wie das Kanzleramt und das Auswärtige Amt, die sich mit den Außenbeziehungen beschäftigen, haben einen natürlichen Informationsvorsprung vor den Abgeordneten. Sie verhandeln mit den Vertretern anderer Staaten über die Grundlagen und die Einzelheiten der Außenbeziehungen. Die Ergebnisse wie Verträge und Abkommen bedürfen allerdings der Zustimmung des Parlaments. Der Ratifikationsprozeß ist daher die wichtigste Möglichkeit des Bundestages, direkten Einfluß auf die deutsche Außenpolitik zu nehmen.
Die Vernachlässigung der parlamentarischen Außenpolitik durch internationale bzw. Diplomatiehistoriker war lange Zeit auch auf die Quellenlage zurückzuführen. Bis Mitte der neunziger Jahre waren die Protokolle des Auswärtigen Ausschusses der Wissenschaft nicht zugänglich. Abgeordnete konnten die Protokolle beim Ausschussassistenten einsehen. Der sozialdemokratische Abgeordnete Carl-Christoph Schweitzer hat die Protokolle erstmals für seinen Aufsatz »Der Auswärtige Ausschuß des Deutschen Bundestages im außenpolitischen Entscheidungssystem« ausgewertet. Da eine systematische Auswertung der Ausschußprotokolle durch Historiker nicht möglich war, blieb es bei diesem Aufsatz. Abgesehen von den Stenographischen Berichten des Bundestages selbst existieren meines Wissens keine schriftlichen Quellen, in denen die außenpolitische Debatte dieser Jahre so ausführlich dokumentiert ist und die auf einem so hohen Niveau geführt wurde.
Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass sich nicht irgendwelche unbekannten Experten über die deutsche Außenpolitik kontrovers auseinandersetzen, sondern die parlamentarische Elite des Bundestages. Ein Blick auf die Vorsitzenden in den ersten drei Wahlperioden mag dies belegen: Erster Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses war der sozialdemokratische Abgeordnete Carlo Schmid. Ihm folgte Eugen Gerstenmaier in der zweiten Wahlperiode nach, bis er Ende 1954 das Amt das Bundestagspräsidenten übernahm. Sein Nachfolger wurde der Vorsitzende des außenpolitischen Arbeitskreises der Unionsfraktion, Kurt Georg Kiesinger. Als sich Kiesingers Hoffnungen auf ein Ministeramt nach dem großen Wahlsieg Adenauers 1957 zerstoben, wechselte er Anfang 1959 als Ministerpräsident in die Landespolitik. Der von ihm gepflegte Stil der Zusammenarbeit der beiden großen Parteien im Ausschuß erleichterte es ihm ab 1966 als Bundeskanzler, mit den Sozialdemokratien zusammenzuarbeiten. Die Große Koalition wurde von Kiesinger und Herbert Wehner im Auswärtigen Ausschuß vorweggenommen.
Verschiebungen gab es bei der Anzahl der Abgeordneten. In der ersten Wahlperiode wurde der Ausschuß als 21-Auschuß konstituiert, um die Abgeordneten der KPD ausschließen zu können. Nach dem Verbot der Partei wurden der Auswärtige Ausschuß in den folgenden Wahlperioden als 29er Ausschuß konstituiert. Der Auswärtige Ausschuß tagte in den hier betrachteten Wahlperioden häufig: In der ersten Wahlperiode 120 Mal, in der zweiten 79 und in der dritten Wahlperiode 72 Mal. Bis 1955 musste Bundeskanzler Adenauer den Ausschussabgeordneten als Außenminister selbst Rede und Antwort stehen. Danach ließ er sich nur ungern im Ausschuß sehen, in der dritten Wahlperiode nur zweimal.
Man kann sich die Sitzungen des Auswärtigen Ausschusses als Konferenzen vorstellen, in denen die Beteiligten versuchen, ihren Standpunkten und Auffassungen Geltung zu verschaffen. Ein Expertengespräch basiert auf einer gründlichen Vorbereitung. Zu diesem Zweck richteten die Fraktionen Arbeitskreise für Außenpolitik ein, in denen sie die Sitzungen des Auswärtigen Ausschusses vor- und nachbearbeiteten. Nicht alle Abgeordnete waren aber dazu in der Lage, dem Zwang zur Professionalisierung so weit nachzugeben, wie es der Unionsabgeordnete Kurt Birrenbach tat. Nach eigenen Angaben sah er sein Mandat im Auswärtigen Ausschusses »wie einen vollen Beruf an, insofern als ich täglich mich mit der Durcharbeitung der Presse der wichtigsten Länder und der Literatur auf dem Gebiete der Außen,- Militär- und Außen-wirtschaftspolitik beschäftige«. Hinzu kämen ständige Informationsreisen.
Ein besonders heikles Problem aller Wahlperioden war der Bruch der Vertraulichkeit durch Ausschußmitglieder. Der Auswärtige Ausschuß und insbesondere die Abgeordneten der Opposition waren auf freimütig weitergegebene Informationen aus dem Munde des Bundeskanzlers und Außenministers angewiesen. Dieser war sowieso nur zögerlich bereit, sich auf die Fragen der Abgeordneten einzulassen. Presseberichte über den Inhalt von Ausschußsitzungen waren ein permanentes Thema in den Ausschußsitzungen. Ein Ausweg war, die Zahl der Teilnehmer zu verkleinern. In der krisenhaften Wochen vor dem Mauerbau 1961 lud Bundesaußenminister von Brentano die ordentlichen Mitglieder – also nicht auch die stellvertretenden Mitglieder – mehrmals zu geheimen Besprechungen in seine Dienstvilla ein.
Wenn der Auswärtige Ausschuß des Bundestages also kaum direkten Einfluß auf die operative Außenpolitik nehmen konnte, welchen Grund sollte die Wissenschaft daher, sich mit ihm zu beschäftigen? Ich analysiere die deutsche Außenpolitik seit nunmehr 15 Jahren. Beim Studium mehr oder weniger staubiger Aktenbestände ist mir bewusst geworden, dass es den Reichs- und Bundesregierungen und dem Auswärtigen Amt im letzten Jahrhundert gelungen ist, die außenpolitische Grundrichtung weitgehend zu bestimmen. Als ich mich im Rahmen meiner Dissertation mit dem Verhältnis Deutschlands zum Völkerbund zwischen 1918 und 1926 beschäftigt habe, habe ich die in der Literatur vorherrschende Auffassung bestätigen können bzw. müssen, dass der Weg über Locarno und den Völkerbundsbeitritt ein Ergebnis klassischer Kabinettsdiplomatie gewesen ist. Im Unterschied zu vielen rein diplomatiegeschichtlichen Darstellungen hatte ich mich schon damals auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie die Öffentlichkeit, die Parteien und die Presse die Wendung von einer Bejahung des Völkerbundes in den Monaten vor Abschluß des Versailler Vertrages über die Verweigerung der Mitgliedschaft im Völkerbund durch die alliierten Siegermächte hin zum erfolgten Beitritt diskutierten. Zu meinen Quellen gehörten auch Berichte über die Sitzungen des Auswärtigen Ausschuß des Reichstages, in denen Außenminister Gustav Stresemann seine Außenpolitik gegen die bohrenden Fragen der Opposition von links und rechts verteidigen musste. Die Debatten im Auswärtigen Ausschuß gaben Aufschluss über die außenpolitischen Denkschulen, über Versuche parteipolitischer Instrumentalisierung der Außenpolitik und das außenpolitische Selbstverständnis der Abgeordneten.
Welche Rolle sollte Deutschland in der Welt spielen, welche Methoden einsetzen, um welche Ziele zu erreichen? Derartige Fragen stellen sich bei Kriegsverlierern in besonderem Maße. Der außenpolitische Aufstieg ist mühsam und mit vielen Rückschlägen verbunden. Wenn die Regierung einen Modus vivendi mit den Siegermächten aushandelt, stellt sich die Frage, wie die Opposition sich zu der neuen Geschäftsgrundlage stellt, ob sie ihn bejaht oder bekämpft.
Für die ersten Jahre der Bundesrepublik gilt das scheinbar paradoxe Fazit: Je geringer die Souveränität des Bundeskanzlers, desto souveräner der Bundeskanzler. Was ist damit gemeint? Die Bundesrepublik erhielt als besiegter Feindstaat des Zweiten Weltkrieges erst nach und nach ihre Souveränität zurück. Die außenpolitischen Wirkungsmöglichkeiten waren bis zur Gründung des Auswärtigen Amts am März 1951 weitgehend darauf beschränkt, im Einvernehmen mit den Vertretern der Alliierten Siegermächte die Westintegration der Bundesrepublik durchzusetzen. Adenauer profitierte in seinen ersten Amtsjahren vom alleinigen und daher privilegierten Zugang zu den Hohen Kommissaren. Da jedes Tun und Unterlassen der Alliierten einen direkten Einfluß auf die deutsche Innenpolitik hatte, bestand die für den Regierungschef außerordentlich günstige Situation, dass er aufgrund seines Informationsvorsprunges mit seiner Außenpolitik die innenpolitische Konstellation in weit größerem Maße beeinflussen konnte als seine parteipolitischen Widersacher. Der Erfolg der von den Westmächten unterstützten Politik vergrößerte den Handlungsspielraum deutscher Außenpolitik. Nach der Erlangung der Souveränität im Mai 1955 waren die Deutschen weitgehend für ihr eigenes Schicksal verantwortlich.
Die (scheinbare) Alternativlosigkeit der deutschen Außenpolitik in den ersten Jahren des Bestehens der Republik hatte es Adenauer vergleichsweise einfach gemacht, die Mehrheit der Deutschen von der Richtigkeit seines außenpolitisches Kurses zu überzeugen. Nun aber, wo von den Deutschen schmerzhafte Entscheidungen etwa bezüglich der Anerkennung der Ostgrenzen und dem Weg zur Wiedervereinigung erwartet wurden, hatte die Bundesrepublik nicht nur an Souveränität und Gleichberechtigung zu gewinnen, sondern auch etwas zu verlieren. Darüber hinaus war das Selbstverständnis der fragilen westdeutschen Demokratie betroffen: Welche Rolle sollte die Bundesrepublik in Europa und in der Welt spielen? Die Beantwortung dieser Frage hatte Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung der deutschen Gesellschaft und vice versa. War die Bundesrepublik nur ein Provisorium, welches allenfalls eine Episode in der Geschichte Deutschlands bleiben würde?
In der Bundesrepublik wurde über diese Fragen engagiert diskutiert. Der wichtigste Ort der Debatte war das Plenum des Deutschen Bundestages. Waldemar Besson hat diesen Befund folgendermaßen zusammengefasst:
Nirgendwo ist diese neuartige Öffentlichkeitsfunktion des Parlaments, die auch eine indirekte Richtungskontrolle durch die Bindung der Regierung an eine kontinuierliche Politik ermöglicht, deutlicher geworden als in den großen parlamentarischen Debatten. Zwischen 1949 und 1960 sind sie zweifellos die Höhepunkte des parlamentarischen Lebens in Deutschland gewesen. Die politische Wirkung dieser Debatten ist um so erstaunlicher, als sie im Gegensatz steht zu der weit verbreiteten Meinung, gerade die Außenpolitik sei dasjenige Gebiet, das eine parlamentarische Behandlung am wenigsten vertrage. In Wahrheit war auf keinem anderen Gebiet der deutschen Politik das Staatsvolk seit 1949 so sehr durch seine Vertretung mitbeteiligt wie eben hier. Die außenpolitischen Debatten waren ein Instrumentarium zur Vertiefung der parlamentarischen Demokratie.
Die Abrechnungen der ehemaligen Minister Adenauers, Thomas Dehler und Gustav Heinemann in der berühmten Bundestagsdebatte vom 23. Januar 1958 haben die Deutschen seinerzeit emotional stärker mitgenommen als alle Debatten über andere Politikfelder. Die öffentliche, häufig polemisch geführte parlamentarische Debatte stand in einem Spannungsverhältnis zur vertraulichen Ausschusssitzung ohne Publikum.
Um auf den Titel dieses Beitrags zurückzukommen: »Es geht nicht um die gemeinsame, es geht um die richtige Außenpolitik.« Mit diesen Worten versuchte Bundesaußenminister von Brentano in der denkwürdigen Bundestagsdebatte vom 30. Juni 1960 die Opposition von der Überlegenheit der außenpolitischen Konzeption der Bundesregierung zu überzeugen. Durch die Herstellung eines gemeinsamen außenpolitischen Konsenses in der Ostpolitik gelang es der Sozialdemokratie, dem Ansinnen des Außenministers eine eigene Konzeption gegenüberzustellen. Der Stilwandel der sozialdemokratischen Opposition von einer Politik der Konfrontation zu einer Politik der Gemeinsamkeit in großem Maße durch die Institutionen des Parlaments mitgeprägt wurden. Die sachliche und wichtiger noch, vertrauliche Aussprache im Ausschuß erleichterte es der SPD, sich der Westpolitik Adenauers anzuschließen.
Literatur:
– Besson, Waldemar: Die aussenpolitische Debatte. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Bundestages, in: Führung und Bildung in der heutigen Welt. Festschrift zum 60. Geburtstag von Kurt Georg Kiesinger, Stuttgart 1964, S. 280–287.
– Hölscher, Wolfgang (Bearb.): Der Auswärtige Ausschuß des Deutschen Bundestages. Sitzungsprotokolle 1949–1953, Düsseldorf 1998.
– Hölscher, Wolfgang (Bearb.): Der Auswärtige Ausschuß des Deutschen Bundestages. Sitzungsprotokolle 1953–1957, Düsseldorf 2002.
– Schweitzer, Carl-Christoph: Der Auswärtige Ausschuß des Deutschen Bundestages im außenpolitischen Entscheidungssystem, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 19/1980, S. 3-24.
– Wintzer, Joachim: Deutschland und der Völkerbund 1918–1926, Paderborn 2006.
– Wintzer, Joachim und Josef Boyer (Bearb.): Der Auswärtige Ausschuß des Deutschen Bundestages. Sitzungsprotokolle 1957–1961, Düsseldorf 2003.